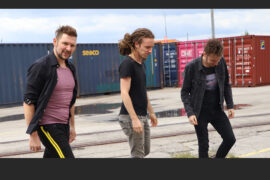Sebastian Simsa
Das frisch veröffentlichte Album des Schlagzeugers zum Anlass genommen, haben wir ihn darüber ausgefragt, wie er es geschafft hat, obwohl er sich für einen schlechten Komponisten hält, ein ganzes Album voller Songs zu schreiben. Auch erzählt hat er uns, warum die ungewöhnliche Besetzung seiner Band so gut funktioniert und was er beim Spielen von Musik für Kinder über Bühnenpräsenz gelernt hat.

Vor kurzem, am 21. September, ist dein erstes eigenes Album erschienen. Was kann man sich davon erwarten?
Das ist eine wilde Mischung aus Jazz und Klassik mit Einflüssen aus der Volksmusik. Viele sagen es ist Filmmusik, die anderen sagen es hat mittelalterliche Einschläge. Die Wurzeln sind jedenfalls im Jazz, aber durch die ungewöhnliche Besetzung mit zwei Streichern hat es einen kammermusikalischen Anklang.
Wie kam es denn zu der Besetzung?
Das Sopransaxophon war immer schon mein Lieblingssaxophon und es war klar, wenn ich einmal selber etwas mache und da ist Saxophon dabei, dann ist das Sopransaxophon. Ich wusste auch, ich will Streicher dabeihaben, weil ich deren Sound super finde und ich kein typisches Klaviertrio wollte. Bevor wir zu proben begonnen haben, wusste ich aber noch nicht, ob das mit dem Chello und ohne Kontrabass funktioniert. Schlussendlich passt es für mich aber gut, den Kontrabass wegzulassen, weil sich das mit meinem Bassdrumsound super ausgeht.
Wieso das?
Ich spiele eine Bassdrum ohne Loch und ohne Dämpfung, die sehr tief gestimmt ist. Das gibt einen sehr langen, breiten und mächtigen Bassdrumsound her. Aber er braucht auch sehr viel Platz. Wenn man versucht das mit Kontrabass zu mischen, kommen sich die Frequenzen total in die Quere. In einer anderen Band mussten wir im Nachhinein Kompromisse bezüglich des Bassdrumsounds eingehen, da sonst der Bass überdeckt worden wäre. Wir mussten also an den Equalizern drehen, um die Bassdrum punktueller klingen zu lassen.
Wie kommt ein Schlagzeuger eigentlich dazu, Musik zu komponieren?
Ich hatte schon ab meiner Oberstufenzeit das Bedürfnis selber Songs zu schreiben. In meiner ersten Pop-Coverband haben wir damals angefangen, Lieder zu schreiben und ich habe mich immer so gequält, weil ich nicht der Typ bin, der Texte schreibt. Irgendwo in der Lade gibt es noch eine Mappe mit meinen alten Texten, aber meistens ist es mir peinlich, wenn ich sie mir selber ansehe. (lacht) Durch das Jazz-Studium habe ich dann andere Wege gefunden, um etwas zu spielen, was von mir ist.
Und mit welchen Mitteln machst du das?
Ich bin ein sehr schlechter Komponist. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, jetzt schreibe ich eine Nummer und die soll so und so sein. Ich bin jemand, der am Klavier sitzt und herumdrückt. Dann finde ich etwas, was mir gefällt und ich höre, was als Nächstes kommen soll. Ich kann nicht sehr gezielt komponieren. Neulich habe ich mich ans Klavier gesetzt und gedacht, jetzt schreibe ich einen schnellen Song im sechs-achtel Takt, weil wir das Feeling noch gar nicht im Programm haben und ich es lässig fände. Als ich dann nach einer halben Stunde die ersten vier Takte hatte und sie aufgeschrieben habe, bin ich draufgekommen, dass sich das nicht ausgeht. Es waren dann zwei fünf-achtel Takte, ein sechs-achtel Takt und noch ein fünf-achtel Takt. (lacht)
Was erwartest du von deiner Zukunft?
Der Plan ist, dass es bei diesem Mix aus Unterrichten und Musikmachen bleibt. Ich rede gern schlau, insofern ist Unterrichten schon mal gut. (lacht) Ich hatte schon früh eine Begeisterung fürs Schlagzeugspielen und fürs Musikmachen und das teile ich gerne. Man muss sich beim Unterrichten Dinge überlegen, die man sich sonst nie überlegt hätte, zum Beispiel wie man etwas eigentlich genau macht. Man erkennt dabei auch, dass man sich an das, was man seinen Schülerinnen und Schülern erzählt, selber beim Üben auch halten sollte. Zum Beispiel auch mal eine Pause machen oder Bewegungsabläufe in einen musikalischen Kontext bringen und in Verbindung mit einem Groove üben. Spielen will ich weiterhin, das ist sowieso klar. Aber ich habe keine Lust nur vom Spielen zu leben und jedem Job, den es zu spielen gibt, hinterher laufen zu müssen.

Und dein eigenes Projekt, spielt das in deiner Zukunft auch eine Rolle?
Ja, das ist jetzt mal mein Startup. Da gehen sehr viel Arbeitszeit, Energie und Gedanken hinein, in der Hoffnung, dass es mir auf lange Sicht hilft. Ich bin dadurch präsent und es kommen Konzerte an Land. Aber jetzt ist erstmal Reinbuttern angesagt. Ich denke mir nicht, jetzt habe ich eine CD gemacht und das ist erledigt. Für mich ist das eigentlich der Startpunkt. Jetzt sind es Simsa Fünf und das bleibt es mal. Ob die nächste CD Simsa Fünf oder Simsa Drei oder Simsa Zehn ist, das hab ich mir noch nicht überlegt.
Mich würde noch interessieren, weil wir zuvor über das Unterrichten gesprochen haben, ob du so etwas wie eine Unterrichtsphilosophie hast?
Mein Ziel ist es, das Interesse der Schülerinnen oder Schüler so weit anzukitzeln, dass von ihnen die Fragen kommen. Auf lange Sicht wird es mit keinem Instrument ohne üben funktionieren. Deshalb ist es auch mein Ziel, das Interesse für das Instrument und den Ehrgeiz, etwas zu können, was man noch nicht kann, so weit zu wecken, dass auch ein gewisses Interesse für das Üben kommt. Die meisten kommen ja, weil sie irgendwas interessiert oder begeistert. Und das versuche ich herauszufinden und zu stärken. Das ist für mich das Interessante.
Ich habe gesehen, du machst Musik für Kinder, Kindermusicals und Kindertheater. Was ist anders, wenn man ein Konzert für Kinder spielt im Vergleich zu einem Konzert für Erwachsene?
Die Uhrzeit! (lacht) Kinder sind oft direkter und es ist viel mehr Kommunikation da. Gibt es keinen direkten, zum Teil auch verbalen Kontakt zu den Kindern, dann verliert man sie sehr schnell. Du gehst nicht auf ein Konzert für Erwachsene und fragst: „Und wer spielt bei euch ein Instrument und welches spielt ihr denn?“ Ursprünglich dachte ich, bei Kindern muss ich auf der Bühne noch präsenter sein als bei Erwachsenen. Jetzt denke ich mir immer, warum sollte ich bei Erwachsenen nicht präsent sein? Ich habe versucht, das ein bisschen mehr mit zu den Erwachsenenkonzerten zu nehmen.
Was genau meinst du mit präsent sein?
Ich möchte auf die Bühne gehen und wirklich da sein. Es geht darum, wie ich dasitze, das wahrnehme und die Leute ansehe. Ich sitze auf einer Bühne und spiele nicht für mich, wie im Proberaum. Die Leute zahlen ja auch Eintritt dafür. Es geht dabei nicht darum eine gekünstelte Show zu machen, aber wenn ich im Publikum sitze und ich sehe jemanden, der nur für sich spielt, dann denke ich mir oft: Okay, ich komme ein anderes Mal wieder. (lacht) Meistens ist das Erste, was ich wahrnehme aber nicht das Publikum, sondern das sind zuerst meine Kolleginnen und Kollegen. Manchmal bin ich schon aus Proben rausgegangen und habe mir gedacht, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was der Pianist spielt, hätte ich keine Ahnung. Ich war einfach froh, dass ich meinen Groove rausgekriegt habe, weil der extrem schwer war. Bei meiner Band ist es jetzt genau umgekehrt, da bin ich Bandleader und muss mitbekommen, was die anderen tun. Das habe ich versucht, für andere Projekte mitzunehmen.
Wo ist für dich dann die Grenze zwischen präsent sein und eine Show abziehen?
Wenn ich präsent bin, gehe ich auf die Bühne und zeige, ich fühle mich wohl, erzähle gerne was zu meinen Stücken und habe Spaß dran. Solange ich etwas begeistert von mir gebe, was mir gefällt, dann ist das nicht eine Show abziehen. Der Sänger von Bilderbuch hat einmal in einem Interview gesagt, das ist wie bei einer Zitrone. Du findest das, was den Geschmack hat und dann presst du das aus und präsentierst es den Leuten. Man nimmt etwas von sich und das ist ein Teil von einem selbst, aber auch nicht alles. Solange du etwas von dir nimmst und es verstärkst, ist es keine Show.
Foto 1: Alexander Gotter
Foto 2: Georg Buxhofer
Interview: Mira Achter